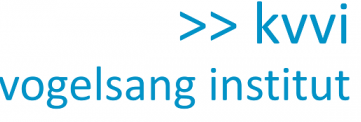Bundesminister a.D.
Univ.-Prof. Dr. Hans Tuppy (1924 bis 2024)
Hans Tuppy als Wissenschaftsminister, ca.1988
Archiv des Karl von Vogelsang-Instituts
Dr. Hans Tuppy konnte auf eine vielbeachtete und herausragende Wissenschaftslaufbahn zurückblicken. Seine naturwissenschaftlichen Arbeiten im Bereich der Chemie, die ihn an zahlreiche internationale Universitäten führten (Cambridge, Kopenhagen), begründeten seinen Ruf als exzellenten Forscher. Neben seinen wissenschaftlichen Studien betrachtete Tuppy stets kritisch und zugleich fördernd den politischen Rahmen, der Wissenschaft erst ermöglichte. Die Österreichische Volkspartei konnte über Jahrzehnte auf seine kritische, doch substanzielle Mitarbeit zählen, und ihn von 1987 bis 1989 mit der Führung des Wissenschaftsministeriums betrauen.
Zu den Schwerpunkten Hans Tuppys als Bundesminister für Wissenschaft und Forschung (1987-1989) zählten die Novellen zum Universitäts-Organisationsgesetz (1987, 1988), die Erweiterung des Handlungsspielraumes von Universitäten und ihren Einrichtungen in der Kooperation mit Dritten durch Ausweitung der Rechtsfähigkeit und selbständige Gebarung im Rahmen ihrer Rechtsfähigkeit, Verbesserung der Stellung von Gastvortragenden, das Akademie-Organisationsgesetz (1987), die Anpassung der Organisation der Akademie der bildenden Künste in Wien an die Erfordernisse einer zeitgemäßen Hochschulstruktur und eines modernen Hochschul-Managements, die Novelle zum Allgemeinen Hochschul-Studiengesetz (1988), die Verankerung der Möglichkeit internationaler Studienprogramme und von Studien in einer Fremdsprache sowie die Novelle zum Kunsthochschul-Studiengesetz (1988).
Dr. Hans Tuppy repräsentierte alleine durch seine wissenschaftliche und politische Biographie einen prominenten Zeitzeugen für die Veränderung österreichischer Forschungs- und Wissenschaftspolitik. Sein Leben und sein Wirken als Wissenschaftler und Politiker stehen für die Brüche und Kontinuitäten derselben.
Das Karl von Vogelsang-Institut führte im Jahre 2013 im Rahmen eines Projekts zur „Österreichischen Wissenschaftspolitik 1960-2010‘‘ ein Zeitzeugen-Interview mit Hans Tuppy. Dieses Gespräch dürfen wir in Auszügen als historisches Dokument anführen.
Dr. Hans TUPPY
Geb. 27. Juli 1924 in Wien
1942-1948 Studium der Chemie in Wien
1958 Habilitation und a.o. Univ.-Prof. für Biochemie an der Medizinischen Fakultät der Universität Wien
1974-1982 Präsident des Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF)
1983-1985 Rektor der Universität Wien
1985-1987 Präsident der ÖAW
1987-1989 Bundesminister für Wissenschaft und Forschung
Zeitzeugen-Interview
Univ.-Prof. Dr. Hans Tuppy
Dieses Gespräch wurde im Mai 2013 im Rahmen eines Projekts zur „Österreichischen Wissenschaftspolitik 1960-2010“ von Dr. Johannes Schönner mit Bundesminister a.D. Univ.-Prof. Dr. Hans Tuppy auf der Politischen Akademie geführt. Manche Themen beziehen sich auf seinerzeit aktuelle Entwicklungen wie die damals erfolgte Zusammenlegung von Wirtschafts- und Wissenschaftsministerium. (Auszüge)
Johannes Schönner:
Herr Professor Tuppy, sehen Sie in der augenblicklichen Zusammenlegung von Wissenschaftsministerium und Wirtschaftsministerium eine sinnvolle Ergänzung mit folgenden Synergien oder einen Zusammenstoß von Interessen?
Hans Tuppy:
Ich bin durchaus nicht gegen die Vereinigung der beiden Bereiche. Ohne Wirtschaft gibt es keine konsequente Wissenschaft sowie Forschung und auch die Wissenschaft ermöglicht oftmals erst eine erfolgreiche Wirtschaft.
Johannes Schönner:
Herr Professor Tuppy, ihre Arbeits- und Forschungsschwerpunkte, jedoch auch ihre Schwerpunkte, die Sie als Wissenschaftsminister hervorgehoben haben, sind beachtlich. Alleine das Hochschulwesen, die Novelle zum Universitätsorganisationsgesetz 1987/88, Akademieorganisationsgesetz 1987, diverse Novellen sind wesentlich hier anzuführen. Schließlich das Allgemeine Hochschulorganisationsgesetz 1988, das Kunsthochschulenstudiengesetz 1988, schließlich das Studienförderungsgesetz. In Ihrer Amtszeit hat der FWF die Mittel entschieden erhöht. Dadurch wurden enorme neue Forschungsmöglichkeiten ermöglicht.
Hans Tuppy:
Ich war damals fest davon überzeugt, dass es eine der besten Möglichkeiten ist. Das ist eines der besten und wirksamsten Mittel gewesen, Geld in die Hochschullandschaft zu bringen; in einer Weise, die sich dann eben auch leistungsmäßig positiv auswirkt. Schon bei der Gründung des Fonds war ich dagegen, dass man auch Bauten und Dinge, die nicht zur Wissenschaft beitragen, mitfinanziert. Die Gefahr ist immer bei einer Aufwendung für Wissenschaft groß, dass es in Administration, in Bauten, in Infrastruktur etc. versickert. Das war allerdings ein Gedanke, den ich auch innerhalb der Regierung nicht so ohne weiteres kommunizieren konnte. Ich sollte doch froh sein, wenn die Universitäten neue Bauten bekommen, bekam ich immer wieder zu hören. Ja, das war ich auch. Doch wenn die Wissenschaft und die Forschung dadurch zu kurz kamen, hielt sich meine Freude in Grenzen. Vor allem die Bundesmuseen waren hier nicht unproblematisch. Ich möchte daher sagen, diese Jahre waren sehr fordernd.
Johannes Schönner:
Das war wahrscheinlich auch mit ein Konfliktpunkt mit den Direktoren der Bundesmuseen. Die Museen wollten ja vor allem ihre Häuser ausbauen.
Hans Tuppy:
Es hat freilich alles zwei Seiten. Von ihrer Warte aus hatten die Museumsdirektoren schon grundsätzlich recht. Sie mussten auch ständig Mittel einfordern, wenn man bedenkt, dass das Kunsthistorische Museum, aber auch das Naturhistorische Museum in einem furchtbaren Zustand waren. Die haben wirklich finanzielle Mittel für Renovierungsarbeiten gebraucht. Übrigens glaube ich auch gegenwärtig, dass zu viel Geldmittel in Administration gehen. Heute würde ich mir wünschen, wenn mehr Bauten-Gelder zur Verfügung stünden und das Geld weniger in die Administration und oft ermüdende, oft nicht notwendige Evaluierung fließt. Evaluierung ist gut und schön, Evaluierung ist wichtig in der heutigen Zeit. Die Arbeit zu bewerten, auch von externen, ausländischen Fachprofessoren, die anonymisiert werden. Die diversen Peer-Review-Systeme haben durchaus internationalen Stellenwert und sind im Prinzip unverzichtbar. Aber wenn der Evaluierungsaufwand die eigene Forschungs- und Lehrtätigkeit entscheidend beeinträchtigt, dann stellt sich die Frage nach dem Sinn der Evaluierung.
Johannes Schönner:
Warum glauben Sie, fallen die österreichischen Universitäten, vor allem die Wiener Universität oder die TU Graz, die früher Flaggschiffe Österreichs waren, im internationalen Ranking, immer weiter zurück? Warum glauben Sie, fallen wir generell im internationalen Vergleich zurück? Liegt es nur am Geld, an den Forschungsmitteln oder gibt es auch strukturelle Probleme?
Hans Tuppy:
Das hängt alles grundsätzlich zusammen. Also, dass die Universität Wien jetzt noch schlechter ist als vor dem Jahr 2000, das ist zum Teil gar nicht ernst zu nehmen. Das sind auch statistische Schwankungen, so wie bei den Pisa-Untersuchungen. Es gibt nicht nur echte Trends. Da müssen wir wirklich über längere Zeit schauen. Aber als österreichischer Universitätsprofessor und als früherer österreichischer Politiker darf man hier nichts schönreden. Dass wir soweit rückwärts sind, das hat schon verschiedene Gründe. Ein Grund ist, dass wir immer noch glauben, dass wir so etwas Besonderes in der Welt sind, und dass die Welt eigentlich klein ist. Die Welt ist jedoch ungeheuer groß geworden. Was da an Neuem entstanden ist, und auch dauernd entsteht, hat direkten Einfluss auf uns. Somit auch auf unsere Wissenschaftsvorhaben. Jedes Jahr entstehen neue Universitäten, die zum Teil mit enormen Mitteln etabliert werden. Es ist wie bei der Wiener Medizinischen Schule. Es gab um 1900 nur ein paar Hochschulen. Und heute? Beinahe jede größere Stadt hat ihre weiterführenden Schulen und vielleicht sogar Hochschulen und Universitäten. Wissenschaftliche Konkurrenz wird in Österreich nicht positiv besetzt. In England spornt den einzelnen Forscher jeder Mitbewerber extra an. Schauen wir uns doch die Größenverhältnisse an: Wir sind in Europe 2% der Gesamtbevölkerung und weltweit gegen 0,1%. Ich übertreibe bewusst, doch wir müssen Nischen in der Wissenschaft finden und uns gewaltig anstrengen.
Johannes Schönner:
Und hier natürlich die besten Wissenschaftler und Forscher nach Kräften unterstützen. Tun wir das in Österreich? Wir haben Johannes Hengstschläger oder Anton Zeilinger. Es mangelt ja nicht am Humankapital.
Hans Tuppy:
Ich kenne die österreichischen Universitäten sehr gut, auch im Vergleich mit internationalen Standorten in Europa und in den USA. Die exzellenten Kräfte sind in Österreich vorhanden. Und jetzt sind wir bei der Politik, die den Rahmen festlegen muss.
Johannes Schönner:
Ein Politiker denkt jedoch gelegentlich stärker an den Weg. Ein Forscher denkt ans Ziel. Stimmt diese Zuordnung?
Hans Tuppy:
Wobei manche Professoren an den Universitäten auch zuletzt immer mehr den Weg sehen. Ich will nicht so scharf trennen. Das ist oftmals eine bürgerliche Untugend.
Johannes Schönner:
Die Politik lässt auch oftmals nichts unversucht, dieses Klischee zu fördern.
Hans Tuppy:
Es sind im medialen Bereich meistens gestrandete Akademiker. Ich fürchte, dies ist auch in der Wissenschaftspolitik, respektive der Darstellung der Wissenschaft in der Öffentlichkeit, ein wesentlicher Umstand. Das Scheitern in der Wissenschaft wird mitunter größer dargestellt als ein Erfolg. Schauen sie sich das Projekt „Galerie der Forschung“ an. Hier hätte Wissenschaft sehr gut „unter das Volk gebracht“ werden können.
Die österreichische Bevölkerung weiß, dass Forschung und Wissenschaft etwas kosten darf. In manchen Bereichen auch wirklich teuer ist. Aber wir wissen nur zu gut, es scheitert nicht nur am Geld. Wie auch in der gesamten Bildungsdiskussion, so ist es auch im Wissenschaftsbereich. Stellenweise sind sozialdemokratische Positionen und jene der Volkspartei unvereinbar. Das beginnt bei der Schulpolitik und setzt sich fort auf den Hochschulen. Doch ich denke, die EU hat hier zumindest eine gewisse Entspannung mit sich gebracht.
Johannes Schönner:
Herr Professor Tuppy, Sie haben jetzt schon die Internationalität angesprochen, die in den letzten Jahrzenten immer stärker wurde und immer stärker wird. Allein von US-amerikanischer, indischer, fernöstlicher, aber auch arabischer Seite werden hier Tatsachen geschaffen, an denen niemand vorbeikommt. Die arabischen Staaten investieren enorme Summen in Forschungsprojekte, gerade in den Medizin- und in Pharmabereich. Die besten Köpfe von Österreich, die sind mitunter im Ausland.
Hans Tuppy:
Hier haben sie grundsätzlich Recht. Die kommen aber wieder nach Österreich zurück. Wenn sie genug Geld verdient haben, kommen sie wieder.
Johannes Schönner:
Wie schätzen Sie überhaupt den sogenannten „Bologna-Prozess“ ein? Wird das auch zunehmend für die österreichische Wissenschaft und Forschung problematisch, oder haben wir den Zug generell bereits versäumt? Haben wir verabsäumt, junge Wissenschaftler und Forscher zu animieren im Ausland zu studieren? Österreichern sagt man eine gewisse Immobilität nach. Die Stipendien für das Ausland werden – seit Anfang der 2000er Jahre wiederholt sich diese Feststellung seitens der Politik, aber auch der Universitäten – nicht in Anspruch genommen.
Hans Tuppy:
Das hat eher früher gegolten. Meiner Erfahrung nach hat sich das aber mit dem EU-Beitritt entscheidend geändert. Und wenn ich sozusagen auch eine Konstante in meinem Lebenslauf erwähnen darf:
In meinem wissenschaftlichen Arbeiten und als Hochschullehrer musste jeder Dissertant oder späterer Doktor ins Ausland. Sonst hatte er keine Chance bei uns gehabt. Sie mussten sich an ausländischen Universitäten bewähren. Beim Forschungsförderungsgesetz hat man dies auch seitens der österreichischen Politik sehr stark berücksichtigt. Nachher wurden nur ausländische Gutachter bei gewissen Prüfungen oder Entscheidungen herangezogen, nicht die eigenen. Als Minister bin ich ja unglaublich gescholten worden. Wenn man da die Zeitungen nachliest, würde man dies wieder realisieren. Ich war auch für den Bachelor als Studienabschluss. In dieser Frage ging ein Sturm der Entrüstung anfangs durch die österreichische Presse. Auch die Professorenkollegen auf den Universitäten gingen hier nicht zimperlich mit mir um. Als Minister habe ich das erklärt. Nicht zuletzt auch im Parlament in Wien. Wobei ich der festen Überzeugung war, dass diese Angleichung ans europäische Universitätssystem sinnvoll ist und uns US-amerikanische Stärken bringen würde – ohne deren Schwächen, die es freilich auch gibt, wie die reine Abhängigkeit von der US-Wirtschaft – zu importieren. Aber wie dann die bürgerliche Presse, die ja sehr konservativ und starr ist, mit mir umgegangen ist, war letztklassig.
Johannes Schönner:
Haben Sie da keine Unterstützung erfahren?
Hans Tuppy:
Nein, überhaupt nicht.
Johannes Schönner:
Wie schätzen Sie grundsätzlich die gesellschaftlichen Paradigmenwechsel der letzten Jahrzehnte und deren Auswirkungen auf die Wissenschaftspolitik ein?
Gibt es hier einen Zusammenhang mit der gesellschaftlichen Veränderung und auch dem Stellenwert der Hochschulen?
Hans Tuppy:
Nun, selbstverständlich gibt es den Zusammenhang. Nur glaube ich nicht an so starke Brüche, wonach die ganze Gesellschaft dadurch beeinflusst wurde. Es ist viel kontinuierlicher, schrittweise geschehen. Wenn ich daran denke, dass Unterrichtsminister Theodor Piffl-Percevic 1966 die Studienreform in Angriff genommen hat, eine Kommission eingerichtet hat, in der er nicht nur Leute seiner Couleur, sondern auch andere aufgenommen hat.
Das war schon eine interessante Änderung gegenüber seinem Vorgänger Drimmel. Dieser hat nur das, was gesetzlich festgeschrieben war, in Angriff genommen. Aber Drimmel hat nichts Neues gebracht. Piffl war ganz anders. Das war schon ein neuer Typ. Obwohl er unglaublich konservativ war, in vielerlei Hinsicht. Ein altösterreichischer Adeliger, sein ganzes Auftreten, sein ganzer Stil, war nicht bürgerlich, sondern adelig. Dadurch vielleicht sehr steirisch. Piffl hat schon politisch erstaunlich viel gemacht. Und überhaupt, vergessen wir die Klaus-Zeit nicht. Josef Klaus hat es zur parlamentarischen Mehrheit gebracht. Warum? Weil er eine Vision gehabt hat, und die Vision war zum Teil auch eine wissenschaftliche Agenda. Er war tief beeindruckt von der Kybernetik, von der Wissenschaft der Steuerung. Bundeskanzler Klaus hat gemeint, dass man mit solchen Vorstellungen einer Steuerung auch in der Politik sehr viel anfangen kann. Für die Aktion 20 hat er sich die wissenschaftliche Expertise in die Regierung geholt, weil er von dieser Überzeugung geprägt war. Und das Forschungsförderungsgesetz wäre nie so gut geworden, wenn es nicht die Alleinregierung gegeben hätte. In diesem Fall hat ein Mann im Kanzleramt doch erstaunlich viel durchsetzen können – oder es zumindest versucht. Es gab und gibt leider sehr, sehr wenige von dieser Art wie es der Politiker Josef Klaus war. Er hat freilich auch seine Schattenseiten gehabt. Nicht dass Josef Klaus jetzt ein sakrosankter Heros gewesen ist. In dieser Hinsicht ist vieles eben nicht durch Hertha Firnberg gestartet worden. Es war schon eine Menge politischer Arbeit vorbereitet gewesen. Denken wir an die Aktion 20, die für vieles die Grundlage gelegt hat. Immerhin war es bereits vor Bruno Kreisky vorbereitet gewesen.
Johannes Schönner:
Sie haben jetzt ein Stichwort gegeben: Die Aktion 20. Josef Klaus war einer der Ersten, der den gesellschaftspolitischen Wert der Wissenschaft erkannt hat. Die Aktion 20, die dann abrupt durch den Wechsel im Kanzleramt beendet worden war. Der Form nach bestand sie bis 1973/74, doch ohne realpolitischen Einfluss.
Hans Tuppy:
Da gab es auch innerparteilich bereits Vorarbeiten während der frühen 1960er Jahre, die Aktion 20 wurde ab Mitte des Jahrzehnts zu einer breiten Organisation ausgebaut. Bereits Heinrich Drimmel hatte hier Schwerpunkte gelegt. Das war zu einer Zeit, also Ende der 1950er, Anfang 1960er, als die Sozialdemokraten am Thema Wissenschaftspolitik überhaupt kein Interesse zeigten.
Johannes Schönner:
Die ÖVP hat also bewusst die Universitäten und ihre wissenschaftliche Monopolstellung verlassen, um Wissenschaftspolitik zu einem Thema zu machen?
Hans Tuppy:
Gewissermaßen ja, doch das war anfangs innerlich zerrissen und unstrukturiert. Es fehlte noch unter Alfons Gorbach der stringente Faden. Erst Josef Klaus hat klare Zielvorgaben innerhalb aller „Aktion 20-Arbeitskreise“ definiert.
Johannes Schönner:
Es ist heute noch beeindruckend zu sehen, wie viele Persönlichkeiten sich von der Aktion 20 und von Bundeskanzler Josef Klaus angesprochen fühlten und dabei mittaten. Erika Weinzierl, die auch in der Aktion 20 in dem Bereich Geschichte mitgearbeitet hat, war ebenso vertreten wie Gerhard Bruckmann, der hinsichtlich Mathematik und Statistik versuchte, diese in relevante Politikfelder einzugliedern. Die Themen wurden immer breiter. Die Künstler kamen ebenfalls zu Wort.
Hans Tuppy:
Es gibt ja die Erwachsenenbildung, die oft nicht weiter als bis ins nächste Dorf reicht. Nichts gegen das Dorf, ich bin sehr dafür, ich war in der Erwachsenenbildung tätig, aber dafür war es einfach nicht richtig. Diesen Fehler machten auch manche Arbeitskreise der Aktion 20. Jedoch wurde das noch übertroffen von Bruno Kreisky zehn Jahre später. Allerdings verkaufte er sich und auch seine Politik viel besser.
Johannes Schönner:
Sie kennen Theorie und Praxis der Wissenschaft. Mit Theorie meine ich den politischen Überbau, als auch die Praxis des Forschens und der Lehre. Die Basis des Forschens hat sich verändert. Auf einmal gab es Medien, die sich der Forschung angenommen haben. Auf einmal gab es Einrichtungen der Erwachsenenbildung, die sich als wissenschaftliche Institute definiert haben. Ab den späten 1960er Jahren entwickelt sich auf den Unis ein immer selbstbewussterer Mittelbau, eine immer selbstbewusstere und fordernde Studentenschaft. Wie haben Sie als Universitätsprofessor, aber auch als Mitglied der Aktion 20, diesen großen Bruch, der 1960er und 1970er Jahre wahrgenommen?
Hans Tuppy:
Das hängt aber auch mit meinem persönlichen Lebensweg zusammen. Ich habe ja 1945 an der Gründung der Freien Österreichischen Studentenschaft teilgenommen. Ich war also Studentenvertreter und bin dann immer an der Politik interessiert und auch engagiert geblieben, durch alle verschiedenen Ränge hindurch. Ich habe mir nicht schwergetan, auch im „68-Jahr“ und in späteren Jahren als Universitätsprofessor. Man war nicht plötzlich ein anderer geworden.
Wir neigen in Österreich zu sehr auf die Gefahren zu sehen, und zu wenig die Chancen im Fokus zu haben. Aber natürlich ist auch die Wissenschaftspolitik vor Oberflächlichkeit nicht gewahrt. Der Zeitgeist verhindert oftmals eine ordentliche Vertiefung mit der notwendigen wissenschaftlichen Technik.
Johannes Schönner:
Wie sehen Sie Wissenschaftspolitik in den Parteiprogrammen der letzten Jahrzehnte verankert? War jetzt in der SPÖ, in der ÖVP, aber auch der FPÖ und der Grünen, Ihrer Meinung nach, Wissenschaftspolitik ausreichend berücksichtigt oder zu wenig berücksichtigt? War die ÖVP eine „Wissenschaftspartei“ oder nicht?
Hans Tuppy:
Sicherlich war keine Partei eine ausgesprochene Wissenschaftspartei. Da Hertha Firnberg das Wissenschaftsministerium ab den frühen 1970er Jahren etabliert hat, noch eher die Sozialisten. Aber nein, eine ausgesprochene „Wissenschaftspartei“ war keine der genannten Parteien. Auch nicht jene in der Opposition. Ich glaube auch nicht, dass Wissenschaft in einem Parteiprogramm so eine prominente Position haben sollte. Ich glaube schon, Wissenschaft sollte einen politischen Stellenwert haben und zwar in allen Parteien.
Sicherlich gab es den Begriff Forschung mehr in den Naturwissenschaften und in der Medizin, wo sozusagen die Grundlagenentwicklung stärker war. Das hat dann übergegriffen auf alle Gebiete.
Johannes Schönner:
Der Begriff „research“ ist dazu gekommen.
Hans Tuppy:
Ja, und das war enorm wichtig. Nämlich beides: Science and Research. Wobei man bei Science wieder achtgeben muss. Das englische Wort bedeutet etwas anderes als die deutsche Wissenschaft.
Johannes Schönner:
Herr Professor, sehen Sie in den Fachhochschulen, ein Begriff, der noch nicht in dem Gespräch gefallen ist, der aber natürlich auch in Ihre Zeit, bzw. in die Zeit der 1990er Jahre hineinfällt, eine Chance und wissenschaftliche Ergänzung zu den Unis und Hochschulen?
Hans Tuppy:
Da muss man differenzieren. Wenn man die Hochschulen so gliedert, wie es jetzt auch im Bologna-Prozess gewesen ist, haben wir auch einen ersten Abschnitt, der mit einem Bachelor endet. So etwas können die Fachhochschulen ausgezeichnet, manchmal sogar besser. Die Fachhochschulen machen es allerdings nur auf speziellen Gebieten. Und sie machen es auf jenen Gebieten, wo die Entlastung der Universitäten weniger wichtig ist. Die Fachhochschulen setzen oftmals auf bestimmte Gebiete, eher auf die technischen und wirtschaftlichen Fächer. Bei der Wirtschaft ist die Entlastung schon sehr gut.
Die Qualität ist ausgezeichnet, zumindest im Großen und Ganzen. Das Problem ist nur, dass die Fachhochschulen eine Aufnahmebeschränkung haben und zumeist eine Aufnahmeprüfung verlangen können.
Johannes Schönner:
Und dass sie Studiengebühren verlangen können. Eine Universität darf dies im Moment nicht, eine Fachhochschule sehr wohl. Ist das nicht eine demokratiepolitische Ungleichbehandlung?
Hans Tuppy:
Ich persönlich meine, die Fachhochschulen könnten wirklich entlasten, wenn das Gleichgewicht stimmt.
Johannes Schönner:
Sie haben einen Bogen gespannt von der späten Nachkriegszeit bis in die Gegenwart, auch den möglichen Ausblick haben Sie angesprochen. Haben Sie vielleicht auch zu Ihrer eigenen Disziplin, zur Naturwissenschaft, ein abschließendes Resümee? Sehen Sie gegenwärtig die Naturwissenschaften auf dem richtigen Weg?
Hans Tuppy:
Wenn Sie bedenken, dass es heute auf zwei Gebieten der Naturwissenschaften in Österreich wirklich Spitzenkräfte in der Wissenschaft und in der Forschung gibt, dann ist das sehr wenig. Das ist die Quantenphysik, mit den Universitäten in Wien und Innsbruck. Das ist auch verbunden mit der Akademie der Wissenschaften. Der andere Schwerpunkt im Bereich der Naturwissenschaften liegt auf dem Gebiet der Molekularbiologie. Aber es gelingt auf Teilgebieten auch in internationaler Hinsicht etwas Leistungsfähiges hinzustellen.
Die Linken in Österreich mussten sich erst langsam dem Leistungsgedanken annähern. Ohne Leistung schafft man sich schlussendlich selber ab. Das war auch die einzige Möglichkeit, durch wissenschaftliche Leistung etwas zu selektionieren. Das alleine war demokratiepolitisch verträglich. Alles andere ist nicht verträglich.